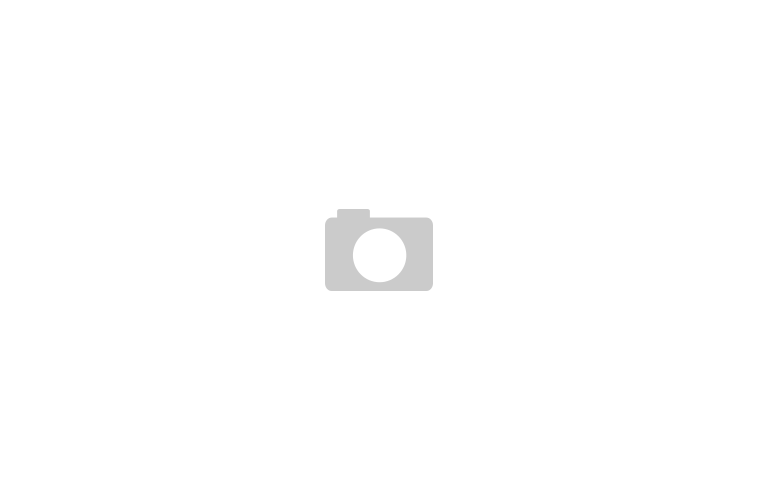Berlin (dpa) – Sie sind Erholungsorte. Holzlieferanten. Kohlendioxid- und Wasserspeicher. Und viel mehr. Zum Internationalen
Tag des Waldes am 21. März weist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO auf die Bedeutung von Wäldern hin. Was bringt das Jahr 2017 für sie?
FRÜHLING: Neben den steigenden Temperaturen auch im Boden ist es vor allem das Licht, das Pflanzen und Tieren im Wald das Winterende signalisiert. «Helligkeit ist ganz entscheidend, davon hängt auch der Gesang der Vögel ab», sagt der Berliner Natur- und Wildtierexperte Derk Ehlert. Bei den Pflanzen seien es Arten wie der Bärlauch, die früh blühten. Das ist eine Überlebensstrategie: Sie nutzen das Licht, bevor die Bäume Blätter bilden und den Boden für Monate verschatten.
WALDHAUPTSTADT: Diesen Titel trägt 2017 der Ort Brilon im Sauerland – vorrangig als Auszeichnung des Zertifizierungssystems PEFC für die Waldwirtschaft nach dem Orkan Kyrill 2007, wie der Leiter des Stadtforstamtes Gerrit Bub sagt. Brilon verlor damals etwa 1000 Hektar seiner 7750 Hektar großen Waldfläche. «Für die Bürger war das ein tiefer Schock», sagt Bub. Die Katastrophe sei als Chance genutzt worden: Aus der Monokultur kommend habe man sich für einen Mischwald entschieden, Bürger einbezogen und tausende Bäume gepflanzt. Der Ort hofft so auf mehr Wald-Stabilität in Zeiten des Klimawandels.
LAUB STATT NADELN: Einen ähnlichen Kurswechsel hat es nach Daten der deutschen Forstwirtschaft auch bundesweit gegeben. Zwischen 2002 und 2012 gingen die mit Nadelbäumen bepflanzten Flächen zugunsten von Laubbäumen zurück. Nadelbäume waren lange bevorzugt worden, weil sie als anspruchsloser gelten, teils auch schneller wachsen. Inzwischen wird das Flächenverhältnis mit 45 Prozent für Laub- und 55 Prozent für Nadelbäume angegeben.
ARTEN: Unverändert stellen Fichte und Kiefer die größten Anteile im deutschen Wald. Der Naturschutzbund (Nabu) sieht Bedarf, noch mehr naturnahe und damit widerstandsfähigere Wälder zu entwickeln. «Wichtig ist, dass es heterogenen Wald gibt», betont Derk Ehlert, «die Mischung macht’s.» Gemeint sind nicht nur verschiedene Arten, sondern auch Generationen und damit unterschiedliche Baumhöhen. Vielfalt kann auch großteils unsichtbar sein: Eine ausgewachsene Eiche habe 600 Arten um sich herum – Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen im Boden inklusive, sagt Ehlert.
KLIMAWANDEL: Stürme, Dürreperioden, Starkregen. Angesichts einer erwarteten Zunahme solcher Wetterextreme glauben Experten, dass es wichtiger wird, die Widerstandsfähigkeit des Waldes zu fördern. Der Waldreferent des Nabu, Stefan Adler, sieht für die Zukunft insbesondere den Wasservorrat im Wald als entscheidend an: «Jeder Baum besteht zu 50 Prozent aus Wasser», sagt er. Besonders relevant ist das bei Hitze: Mittels Verdunstung durch die Bäume kühlt sich der Wald selbst. Um als großer Wasserspeicher zu dienen, sollte möglichst viel Holzvorrat in Form von lebenden Bäumen und Totholz im Wald erhalten bleiben, sagt Adler. Böden funktionierten als Wasserspeicher umso besser, je weniger sie zum Beispiel befahren werden.
GESUNDHEIT: Eine Studie des Bundesamts für Naturschutz zeigte 2016, dass Natur für 94 Prozent der Deutschen zu einem guten Leben dazugehört: Sie verheißt Gesundheit und Erholung. Der Berliner Biopsychologe Peter Walschburger beschreibt den Wald als zentralen Sehnsuchtsort zivilisationsmüder Städter und beobachtet einen anhaltenden Drang zu Sport im Wald. Vogelstimmen, Stille, gute Luft und das Grün als vorherrschende Farbe hätten eine beruhigende, ausgleichende Ausstrahlung, so der Wissenschaftler.
WALDSTERBEN: In den 80er Jahren war das Waldsterben ein großes Thema – Anlass zu kompletter Entwarnung sehen Experten auch 2017 noch nicht. «Der Gesundheitszustand der Wälder hat sich seitdem etwas verbessert», sagt Adler. Kohlekraftwerke zum Beispiel mussten Filter zur Entschwefelung einbauen. Das bedeute aber nicht, dass es dem Wald nun durchweg gut gehe. Der Autoverkehr und die Landwirtschaft sorgten zum Beispiel für hohe Stickstoffeinträge. Dies trage zur Versauerung der Böden bei.
Fotocredits: Julian Stratenschulte
(dpa)