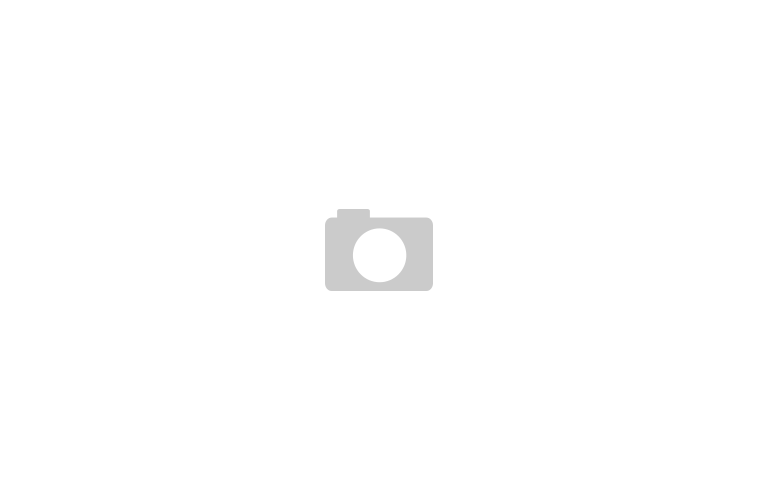Karlsruhe – Hoppla, das sieht ja gar nicht gut aus. Die Brühe ist tiefbraun und schwappt träge vor sich hin. Das kleine Gewässer bei Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) ist trübe. Und tot.
Der aus den USA stammende
Kalikokrebs hat sämtliches Leben dort kurz und klein gefressen. Er breitet sich in Baden-Württemberg rasant aus, und ist bereits ins benachbarte Rheinland-Pfalz eingewandert.
Eingeschleppt wurde er vermutlich von Soldaten der kanadischen Airbase, die einst auf dem Gelände des heutigen Baden-Airpark südwestlich von Rastatt stationiert waren. Jetzt ist er da. «Und wird wohl bleiben», seufzt Biologie-Professor Andreas Martens von der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe. Rund 120 000 Krebse hatte er mit Mitstreitern aus dem Gewässer gefischt – und dann aufgehört zu zählen. Den See hat er wegen seiner Farbe «Milchkaffee» genannt.
Eingeschleppte oder auch
invasive Arten wie der Kalikokrebs machen gleich mehrfach Probleme. Sie breiten sich unkontrolliert aus und verdrängen einheimische Arten schlimmstenfalls komplett. «Die Krebse besetzen kleinere Stand- und Fließgewässer und fressen wirklich alles», erläutert Nabu-Artenschutz-Experte Martin Klatt. «Am Ende bleibt von einem solchen Gewässer nur braune Brühe mit viel Schlamm.»
Invasive Arten können aber – wie der Große Bärenklau oder die Beifuß-Ambrosie – gleichzeitig auch hochgiftig sein oder heftige Allergien auslösen. Und sie richten – etwa große Knöteriche oder Tiere wie Bisamratte oder Nutria – «riesige Schäden an», erklärt Kai-Steffen Frank, Schutzgebietsbetreuer im Kreis Konstanz.
Der Knöterich schafft das durch unterirdische Sprossorgane, sogenannte Rhizome, die sich unter der Erde ausbreiten und in einiger Entfernung der Ursprungspflanze dann wieder zum Vorschein kommen. Die Bisamratte buddelt sich durch Uferbefestigungen und unterhöhlt Straßen und Feldwege. «Die Bisamratte schafft von unten, der Knöterich von oben», sagt Frank. «Gesamte Ufer können dann destabilisiert werden und abrutschen.»
Auf der EU-Liste für invasive Arten, also solche, die nachgewiesenermaßen andere Arten verdrängen, finden sich lediglich 37 Tiere und Pflanzen. «Das ist ein schlechter Scherz», sagt Klatt. Die Zahl invasiver Arten geht seiner Meinung nach in die Hunderte. Auch aus Sicht anderer Experten ist die Grenze zwischen eingeschleppt und «invasiv» fließend. «Das Problem wird deutlich unterbewertet und unterschätzt», sagt Klatt. Die volkswirtschaftlichen Schäden seien enorm.
Zuständig für die Bekämpfung eingeschleppter Arten sind die Landratsämter, die Kommunen, das Land. Das Landratsamt Karlsruhe zieht momentan gegen den Ochsenfrosch zu Felde, «ein großes Problem», sagt Kreisökologe Hans-Martin Flinspach. Der Eindringling aus Nordamerika fiel vor rund 15 Jahren zum ersten Mal in süddeutschen Baggerseen und am Rhein auf. Er vertreibt massiv einheimische Amphibien. Im Sommer hat er Laichzeit; seine Eier werden gerade abgesammelt. Auf erwachsene Frösche wird Jagd gemacht. «Mit Blasrohr und Pfeil», sagt Flinspach. Viele hundert vermutet er in der Region. Zehntausende Kaulquappen dürften es sein. «Ich zweifele daran, dass wir ihn überhaupt noch in den Griff bekommen können», sagt Kai Höpker vom
Landesinstitut für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW).
Außerdem ist Mähzeit für Knöterich oder Goldrute. Je nach Art muss bis zu siebenmal pro Jahr gemäht werden. «Wenn man nicht dran bleibt, hat man verloren», sagt Flinspach. Die hochallergene Pflanze Beifuß-Ambrosie muss sogar ausgerupft oder umgegraben werden – ebenso wie Bärenklau, dem man regelrecht aus dem Boden hacken muss, ergänzt Joachim Schneider, im Karlsruher Landratsamt Leiter des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz. «Wir halten diese Pflanzen gerade so in Schach.» Ausrotten geht höchstens punktuell – auch weil Personal und Geld fehlt.
Der Kampf gegen die eingeschleppten Arten ist teuer. Wie teuer, weiß man auch im Umweltministerium nicht genau. «Für den damit verbundenen Aufwand liegen keine Zahlen vor.» Deshalb handelt man nur dort, wo besonders hohe Sach- oder Gesundheitsschäden drohen. «Mehr Fokus auf die Bekämpfung» und ständiges Monitoring fordert LUBW-Experte Höpker.
Leben ohne eingeschleppte Arten? «In Zeiten der Globalisierung völlig unmöglich», sagt Martens. Muscheln halten sich an Schiffsrümpfen fest oder überleben in Entenbäuchen, bis sie irgendwo wieder ausgeschieden werden. Menschen setzen fremde Arten unbedacht im Wasser aus, Schnecken verstecken sich in Taucheranzügen; Samen werden über importiertes Vogelfutter verstreut. Der Klimawandel tut ein übriges.
Hilft nur Pragmatismus. Das Verhältnis einheimisch-eingeschleppt sei über die Jahrhunderte betrachtet «fifty-fifty», sagt Frank. In den Naturschutzgebieten unternehme das Land viel, um einheimische Arten zu erhalten. «Ansonsten müssen wir uns damit abfinden.»
Fotocredits: Karsten Grabow,Karsten Grabow,Karsten Grabow
(dpa)